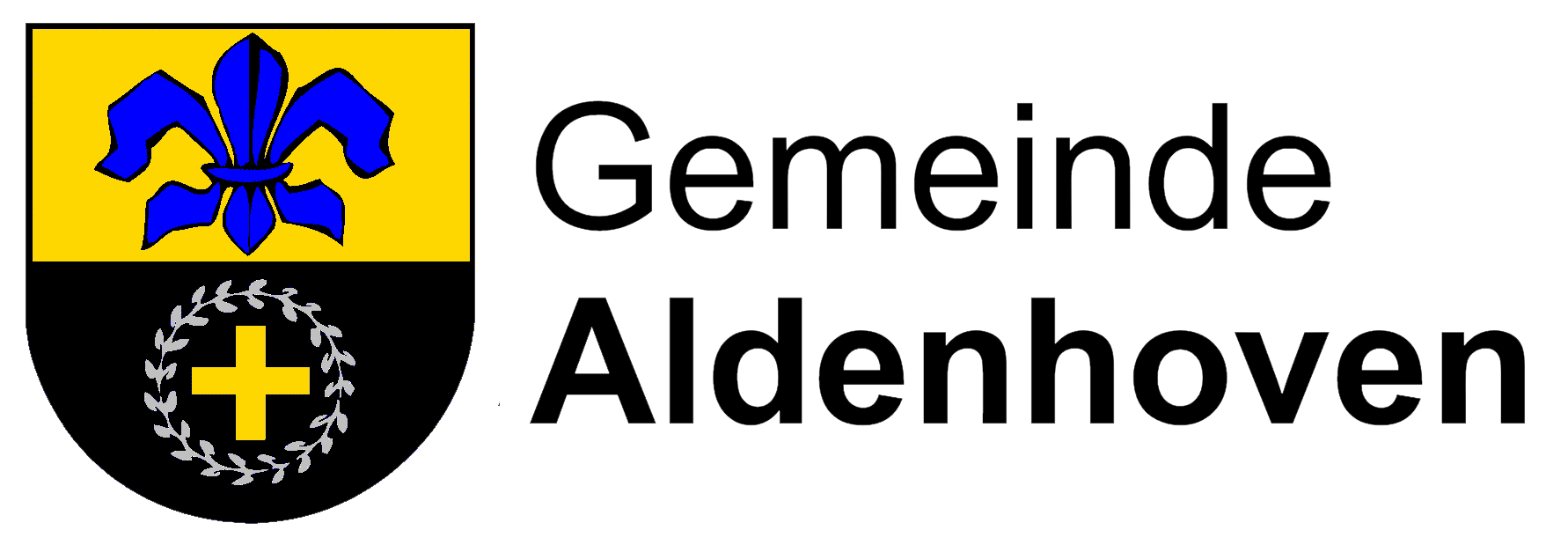Vom ersten Spatenstich 1937 bis zur Absatzkrise im Jahr 1958 - die Geschichte der Schachtanlage "Emil Mayrisch" in Siersdorf.
Hausarbeit von Susanne Roehrig, Bergheim, an der Universität Köln
Der erste Spatenstich zu "Emil Mayrisch"
Ausgehend von der in den Jahren nach dem ersten Weltkrieg gewonnenen Erkenntnis, daß Großbetriebe auch im Bergbau wirtschaftlicher und krisenfester arbeiten als die bis zu diesem Zeitpunkt üblichen kleineren Betriebseinheiten, wurde die Neuanlage von vornherein als Großschachtanlage geplant. Die Entwicklung der Großförderanlagen in den anderen Steinkohlenbezirken hatte gezeigt, daß es bergbautechnisch durchaus möglich war, sehr große Feldergebiete durch eine Schachtanlage zu erschließen und so die Felder, die zu früheren Zeiten von mehreren Doppelschachtanlagen abgebaut wurden, im Abbau zu einem Verbundwerk zusammenzufassen, das aus einer Hauptförderanlage und mehreren kleinen Außenschächten für Seilfahrt, Wetterführung und Materialversorgung besteht (vgl. Stegemann, 1938, i 78f.).
Bereits Mitte des Jahres 1937 wurden die Arbeiten zu der Neuanlage, die eine der modernsten Schachtanlagen Europas werden sollte, aufgenommen. Der Ansatzpunkt für die Hauptschachtanlage wurde wegen der zentralen Lage in den Feldern und der über Tage vorhandenen Ausdehnungsmöglichkeiten nördlich von Siersdorf gewählt. Der Eschweiler Bergwerks-Verein erwarb zunächst ein 99 ha großes Gelände, worauf das Kesselhaus für die Abteufanlage errichtet, die erforderlichen Tiefbrunnen gestoßen und eine provisorische Freileitung von "Maria Hauptschacht" zu dem geplanten Bergwerk gelegt wurden. Weiterhin wurden eine Grubenanschlußbahn und rund 1,3 km Zufahrtsstraßen gebaut. Nachdem Anfang 1938 die Türme zum Abteufen der beiden Schächte fertiggestellt worden waren, begann man mit den Bohrarbeiten für die Herstellung der Gefrierlöcher. Da das Steinkohlendeckgebirge in den betreffenden Grubenfeldern aus wasserführenden, unverfestigten Schwimmsandschichten besteht, mußte das Gefrierverfahren Anwendung finden, das heißt, die Schwimmsandschichten wurden eingefroren und die Schächte anschließend durch das erstarrte Gebirge niedergebracht. Zum Tag der "Weihestunde" der Neuanlage hatte bereits eine der Bohrungen für die beiden Förderschächte das Steinkohlengebirge bei einer Teufe von 452 m erreicht.
Der symbolisch erste Spatenstich zu dem neuen Bergwerk erfolgte am 21.05.1938 im Rahmen einer Feierstunde anläßlich des 100-jährigen Bestehens des Eschweiler Bergwerks-Vereins. Der bei dieser Gelegenheit offiziell bekanntgegebene Name des Bergwerks war schon im Vorfeld der Veranstaltung zum Politikum geraten. Seitens der Nationalsozialisten war die Erwartung geäußert worden, ein derart zukunftsweisender Wirtschaftsbetrieb müsse nach einem ihrer prominenten Führer benannt werden. Da sich der Eschweiler Bergwerks-Verein jedoch - nicht zuletzt auch gegen Widerstände innerhalb der eigenen Reihen - für eine andere Namensgebung entschieden hatte, blieben die Spitzen von Partei und Regierung der Feierstunde fern. Die in den Feldern des Jülicher Landes entstehende Großschachtanlage wurde auf den Namen jenes Mannes getauft, auf dessen Initiative hin der Interessengemeinschaftsvertrag zwischen dem Bergwerksunternehmen und dem luxemburgischen Stahlkonzern ARBED zustande gekommen war, und der nicht zuletzt die westeuropäischen Hüttenwerke zur Internationalen Rohstahlgemeinschaft zusammengeschlossen hatte: Emil Mayrisch (vgl. Schaetzke, 1992, 84).
Zu diesem Zeitpunkt rechnete indessen niemand damit, daß es noch rund fünfzehn Jahre dauern würde, bis die Grube "Emil Mayrisch" die ersten Kohlen fördern würde.
Der zweite Weltkrieg
Nachdem im Sommer 1938 die eigentlichen Abteufarbeiten zu Schacht II begonnen hatten, mußten die Arbeiten mit Ausbruch des zweiten Weltkriegs zunächst für einige Monate unterbrochen werden. Anfang 1940 konnten die Abteufarbeiten bereits wiederaufgenommen werden. In der Folgezeit wurden ein Umspannwerk und ein zweites Freileitungssystem errichtet sowie im besonderen die Abteufungen beider Hauptschächte bis zu einer Teufe von 565 und 662 m vorangetrieben (vgl. De Kull, 1955, 5, 6). Ein schnelles Fortschreiten der Arbeiten war jedoch infolge des sich bald abzeichnenden Mangels an geeigneten Arbeitskräften und vor allem auch an Material nicht möglich. In den ersten Kriegsjahren wurden zunehmend mehr Bergleute zum Wehrdienst herangezogen und durch Kriegsgefangene und sogenannte "Ostarbeiter" ersetzt - bis 1944 waren auf den Gruben des Eschweiler Bergwerks-Vereins neben 14000 deutschen Bergleuten 4500 Kriegsgefangene und Ostarbeiter beschäftigt. Auf höhere Anordnung hin mußten die Aus- und Vorrichtungsarbeiten auf "Emil Mayrisch" eingeschränkt werden, um möglichst viele Arbeitskräfte für die Kohlengewinnung auf den übrigen Gruben des Reviers freizusetzen. Als im August des Jahres 1944 die Front von Westen näherrückte, wurden 4000 Belegschaftsmitglieder aus den Betrieben herausgezogen und bei Schanzarbeiten an der Grenze eingesetzt. Gleichzeitig erfolgte der Abzug der Kriegsgefangenen und Ostarbeiter.
Im September forderte die Parteileitung die Zivilbevölkerung des Aachener Reviers auf, das Gebiet zu räumen und sich evakuieren zu lassen. Mit der Evakuierung kam die Förderung auf den Gruben gänzlich zum Erliegen. Es blieb nur eine Notbelegschaft zurück, die in den letzten Kriegsmonaten, in denen die Städte und Gemeinden des Aachener Reviers abwechselnd unter alliiertem und deutschem Artilleriebeschuß lagen, den Ausfall der Wasserhaltungen und damit das Ersaufen der Schachtanlagen zu verhindern suchte (vgl. Schaetzke, 1992, 85).
Am 21.10.1944 erfolgte die Besetzung Aachens durch amerikanische und englische Verbände. Bis Februar 1945 befanden sich sämtliche Gruben des Aachener Reviers in Händen der Alliierten.
Das weitere Schicksal des Aachener Steinkohlenbergbaus hing nun von der Haltung der Siegermächte gegenüber Deutschland ab (vgl. Schunder, 1968, 277).
Die ersten Nachkriegsjahre
Auch die noch im Abteufen befindliche Grube "Emil Mayrisch" war durch die Kampfhandlungen schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Die bis dahin niedergebrachten Schächte waren bis auf 40 m ersoffen. Die Tagesanlagen wiesen ebenfalls schwerste Zerstörungen auf (vgl. De Kull, i 952, i, 9).
Die Aufräumarbeiten und Instandsetzungen auf den Gruben des Wurmreviers schritten in den ersten beiden Nachkriegsjahren unter der alliierten Militärregierung nur zögernd voran. Seit Sommer 1945 befand sich der Aachener Steinkohlenbergbau unter Aufsicht der "North German Coal Control", die ihre Befugnisse auf die Allgemeine Verfügung Nr. 5 der britischen Militärregierung zum Gesetz Nr. 52 vom 22.12.1945 gründete, nach welcher der Bergbau im Kölner und Helmstedter Gebiet der Verwaltung und Kontrolle durch die alliierten Instanzen unterlag. Aufgrund sachfremder, in erster Linie politischen Interessen folgender Entscheidungen seitens des alliierten Kontrolorgans erging die Betriebsgenehmigung für die Neuanlage "Emil Mayrisch" erst 1947. In selbigem Jahr wurde mit der Gründung der "Deutschen Kohlenbergbau-Leitung" der Steinkohlenbergbau in der britischen und amerikanischen Besatzungszone wieder unter deutsche Zuständigkeit gestellt (vgl. Schunder, 1968, 326 ff.).
Bis dahin waren auf der Schachtbaustelle "Emil Mayrisch" nur verhältnismäßig unplanmäßige Aufräumarbeiten vorgenommen worden, da der Großteil der Bergleute auf Geheiß der Militärregierung auf den bereits in Förderung stehenden Gruben des Reviers beschäftigt war. Mit der Erlaubnis zum Sümpfen der ersoffenen Schächte konnte im September des Jahres 1947, nach nunmehr dreijähriger Unterbrechung, das Abteufen der Schächte fortgesetzt werden. Die Arbeiten wurden jedoch durch den Mangel an Facharbeitern, Material und Energie aufs äußerste erschwert. Infolge der Ereignisse vor allem der letzten Kriegsmonate hatte sich die Stammbelegschaft des Eschweiler Bergwerks-Vereins stark verringert, da ein Teil der Bergleute noch zum Kriegsdienst herangezogen worden war. Viele Bergleute waren gefallen oder wurden durch Verwundungen arbeitsunfähig, andere kehrten erst nach langjähriger Gefangenschaft ins Aachener Revier zurück.
Zudem zeichneten sich die Jahre 1945-48 durch eine allgemeine Mangellage, vor allem auch hinsichtlich der Versorgung der Bevölkerung, aus. In Anbetracht der stetig zunehmenden Entwertung des Geldes konnte der Arbeitswille der Belegschaft nur durch Sonderzuteilungen an Nahrungsmitteln und sonstigen Verbrauchsgütern in Form einer besonderen Werksverpflegung und Care-Paketen aufrechterhalten werden (vgl. EBV, Geschäftsbericht 1945-48, 8). Hinzu kam, daß aufgrund der in den ersten Nachkriegsjahren unbefriedigenden Ertragslage des Eschweiler Bergwerks-Vereins eine ausreichende Tätigkeit auf dem Gebiet des Bergarbeiterwohnungsbaus nicht möglich war, so daß die schlechten Wohnverhältnisse der Bergleute nicht zuletzt einen starken Belegschaftswechsel bedingten, der sich wiederum ungünstig auf die Förderleistung der Betriebe auswirkte (vgl. EBV, Geschäftsbericht 1948/49 und 1950, 10).
Erst die Währungsreform vom 21.06.1948 führte zu einer schrittweisen Verbesserung der gesamten wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse (vgl. EBV, Geschäftsbericht 1957, 23).
Die Aufnahme der Förderung auf "Emil Mayrisch"
Beim Ausbau der Schachtanlage "Emil Mayrisch" hatten beide Schächte 1949 die für den Ansatz der ersten Hauptfördersohle erforderliche Teufe von 710 m erreicht. Bis Ende 1950 war die Auffahrung der ersten Hauptfördersohle bei 710 m Teufe sowie der Wettersohle abgeschlossen. In den Jahren 1951 und 1952 wurde Schacht II bis auf 860 m weitergeteuft und anschließend die 860 m - Hauptfördersohle aufgefahren. Am 15.04.1952 konnte mit der Vorrichtung des ersten Abbaubetriebes die planmäßige Förderung auf "Emil Mayrisch" aufgenommen werden. Bei der geförderten Kohle handelte es sich, den Erwartungen entsprechend, um erstklassige Kokskohle, die bis zum Bau einer eigenen Wäsche (1958) in der Anlage "Anna II" in Alsdorf gewaschen wurde und anschließend zur Veredelung in die Kokerei "Anna" gelangte. Die Jahresfördermenge belief sich in diesem Jahr auf 58.181 Tonnen. Zu gleicher Zeit wurde Schacht II bis auf 884 m weitergeteuft und bei 860 m die zweite Hauptfördersohle angesetzt (vgl. EBV, Geschäftsbericht 1952, 15). Auch die Tagesanlagen der Grube erfuhren einen stetigen Ausbau, etwa 1951-53 der Grubenbahnhof, 1953 die für eine Belegschaft von 3000 Mann vorgesehene Waschkaue und ab 1955 der Betonförderturm des Schachtes II.
Bereits 1956 konnte der 71 m hohe Turm, der - so die Werkszeitung des Eschweiler Bergwerks-Vereins in ihrer Ausgabe vom November 1956 - "[...] wie die Faust eines Riesen in den Himmel ragt" und die Zeche weithin sichtbar machte, seiner Bestimmung übergeben werden. Zwar hatte man bereits seit 1952 an Schacht I Kohlen gefördert, jedoch war die Kapazität der von der stillgelegten Grube "Eschweiler Reserve" stammenden Förderanlage zu beschränkt, um die für die Neuanlage vorgesehene Gesamtleistung erbringen zu können. Mit der Inbetriebnahme der ersten der insgesamt zwei vollautomatisch elektrisch betriebenen Turmfördermaschinen an Schacht II erhöhte sich die Förderkapazität der Anlage von bislang 1750 t täglich auf etwa 5300 Tagestonnen (vgl. De Kull, 1956, 11, 1). In den Jahren 1956 bis 1960 entstanden u. a. die Schachthalle mit Sieberei und Rohkohlenverladung, eine Kohlenwäsche, das Hauptgebäude mit Betriebsbüro und Bad sowie eine erweiterte Waschkaue für 5276 Mann. 1960 begann man mit den Vorarbeiten zum Einbau der zweiten vollautomatischen Fördermaschine in Schacht II, die 1962 in Betrieb genommen werden konnte (vgl. Goertz, 1971, 116). Der hohe Grad der Elektrifizierung - die elektrischen Maschinen- und Förderanlagen untertage wurden zum Teil elektronisch gesteuert und durch optische Signalanlagen von übertage aus überwacht, wobei auf diesem Gebiet Pionierarbeit geleistet wurde - und die frühe Mechanisierung des Abbaubetriebes ließen "Emil Mayrisch" zur Musterzeche des Aachener Steinkohlenbergbaus und zu einer der modernsten Zechenanlagen Europas werden (vgl. De Kull, 1957, 7 sowie Salber, 1987, 41).
Anhand der nachfolgenden Zahlen sei abschließend hervorgehoben, welche Entwicklung die Förderleistung auf "Emil Mayrisch" seit dem Beginn der Förderung im Jahr 1952 nahm (Goertz, 1971, 120):
| Jahr | Jahresförderung in Tonnen |
|---|---|
| 1952 | 58.182 |
| 1953 |
215.912 1)
|
| 1954 |
388.636
|
| 1955 |
456.470
|
| 1956 |
516.453
|
| 1957 |
691.381
|
| 1958 |
719.659
|
| 1959 |
941.021 2)
|
| 1960 |
1.198.255
|
| 1961 |
1.149.173
|
| 1962 |
1.229.583 3)
|
| 1963 |
1.603.351
|
| 1964 |
1.561.569 4)
|
1) Im Februar 1954 wurde erstmalig eine Tagesfördermenge von über 1000 t erzielt.
2) Im November 1959 konnte die Überschreitung der 4000-Tagestonnen-Grenze erreicht werden.
3) 1969 betrug die durchschnittliche Förderleistung 6000 tato.
4) Am 21.2.1964 erbrachte "Emil Mayrisch" mit einer Förderung von 7000 tato Europas höchste Tagesleistung.
Die Absatzkrise 1958
Während noch nach dem zweiten Weltkrieg auf dem einschlägigen Markt ein Mangel an Kohle geherrscht hatte, der sich durch das Inkrafttreten des Montanunionvertrages (1952) aufgrund der daraus erwachsenden Lieferverpflichtungen gegenüber den Vertragspartnern verschärfte und die Bergbauunternehmen zu einer raschen Steigerung der Förderung zwang, verschlechterten sich im Verlauf des Jahres 1958 die Absatzmöglichkeiten der heimischen Steinkohle.
Die Gründe waren sowohl eine vorübergehende Rezession der Stahlindustrie und der Import US-amerikanischer Steinkohle, die während der Mangellage für einen längeren Zeitraum unter Vertrag genommen worden war, als auch die zunehmende Einfuhr preisgünstigen Mineralöls aus dem Nahen Osten (vgl. Sandkaulen, 1994, 31).
Zum ersten Mal seit Kriegsende wuchsen die Steinkohlenhalden in den Revieren der BRD in bedrohliche Höhen. Der Eschweiler Bergwerks-Verein reagierte auf die Absatzschwierigkeiten mit dem Verfahren von Feierschichten, das heißt, einer kurzzeitigen Einstellung der Fördertätigkeit, und der Verhängung eines einstweiligen Einstellungsstops für alle Bereiche des Grubenbetriebes mit Ausnahme der im Ausbau befindlichen Großschachtanlage "Emil Mayrisch" und des Ausbildungswesens.
Trotz aller Anstrengungen des Bergbaus, der Krise durch Rationalisierung der Betriebsstruktur und wirtschaftspolitische Interventionen zu begegnen, war bald nicht mehr zu übersehen, daß es sich bei dem 1958 erfolgten Einbruch um keine vorübergehende Absatzkrise handelte, sondern um den Beginn einer Strukturkrise, in deren Verlauf der Energiemarkt, ausgelöst durch den stark an steigenden Erdölverbrauch, einen grundlegenden Wandel erfuhr, der sich vor allem zu ungunsten der herkömmlichen Formen der Energieversorgung vollzog (vgl. Schaetzke, 1992, 204). Im Hinblick auf den Steinkohlenbergbau kam erschwerend hinzu, daß die Betriebsstruktur eines Bergwerks im Untertagebau äußerst kompliziert ist. Die Erschließung der Flöze erfordert hohen Kapitalaufwand. Zu ihrem Abbau bedarf es des Einsatzes verhältnismäßig vieler Arbeitskräfte. Selbst bei einer vorübergehenden Einschränkung oder Einstellung der Förderung muß der technische Apparat zur Instandhaltung der Grube weiterbetrieben werden, um sie vor dem Verfall zu bewahren. Die Erschließung der Flöze für den zukünftigen Abbau erfordert eine mehrere Jahre vorausgehende Vorrichtung, so daß die Erhöhung oder Senkung des Abbauvolumens längere Zeiträume beansprucht.
In der Folge sah sich der Eschweiler Bergwerks-Verein ebenso wie die übrigen an der Förderung im Aachener Revier beteiligten Bergbauunternehmen gezwungen, zunächst eine Umstrukturierung seiner Anlagen vorzunehmen, etwa durch Zusammenlegung mehrerer Gruben zu einem Verbundwerk, und im Zuge der weiteren Entwicklung, auf die aufgrund der gebotenen Kürze hier nicht näher eingegangen werden kann, ein Bergwerk nach dem anderen stillzulegen.
Mit dem Aufkommen der Kohlekrise im Jahre 1958 nahm der wirtschaftliche Niedergang des Steinkohlenbergbaus im Aachener Revier seinen Anfang, der mit der Einstellung der Förderung auf "Emil Mayrisch" am 18.12.1992 im Einflußbereich des Eschweiler Bergwerks-Vereins und mit der Stillegung der Grube "Sophia Jacoba" am 27.03.1997 im gesamten Revier seinem Ende zuging (vgl. Schatzke, 1992, 258 sowie "Super Sonntag" vom 29.3. 1997).
Ehemaliger EBV-Förderturm
Der Riese im Jülicher Land, entnommen aus "de Kull-Berichte vom Eschweiler Bergwerks-Verein", Heft 1/1956.
Der Riese im Jülicher Land ...
- hatte eine Höhe von genau 71,01 m;
- hatte einen umbauten Raum von etwa 34.000 Kubikmetern (eine normale Bergmannswohnung hat etwa 300 Kubikmeter umbauten Raumes);
- verschlang etwa 643 Tonnen Baustahl und 5610 Kubikmeter Beton. Um dieses Material heranzuschaffen, waren insgesamt 900 Lastzüge voll Kies, ungefähr 100 Spezial-Silolastzüge voll Zement und ein achtzigachsiger Güterzug voll Baustahl erforderlich;
- wog am 9. Dezember 1955 - also noch ohne Maschinen- und Nutzlasten - 13.050 Tonnen; hatte 20.342 Quadratmeter eingeschalte Betonfläche. Die dafür benötigten Bretter würden, aneinandergelegt, eine 1 m breite Bretterstraße von Siersdorf nach Aachen ergeben;
- wurde von der Abteilung Industriebau der Gutehoffnungshütte Oberhausen-Sterkrade unter der örtlichen Bauleitung von Bauleiter Rosing in rund 7 Monaten errichtet;
- konnte durch Einbau von besonderen Kammern in den vier Eckfundamenten gehoben und in jede Richtung bis zu 20 cm seitlich verschoben werden. Er ist also gar nicht so unbeweglich, wie er auf den ersten Blick aussieht.
Gesprengt wurde der Förderturm am 6. Mai 1994 um 9:55 Uhr.